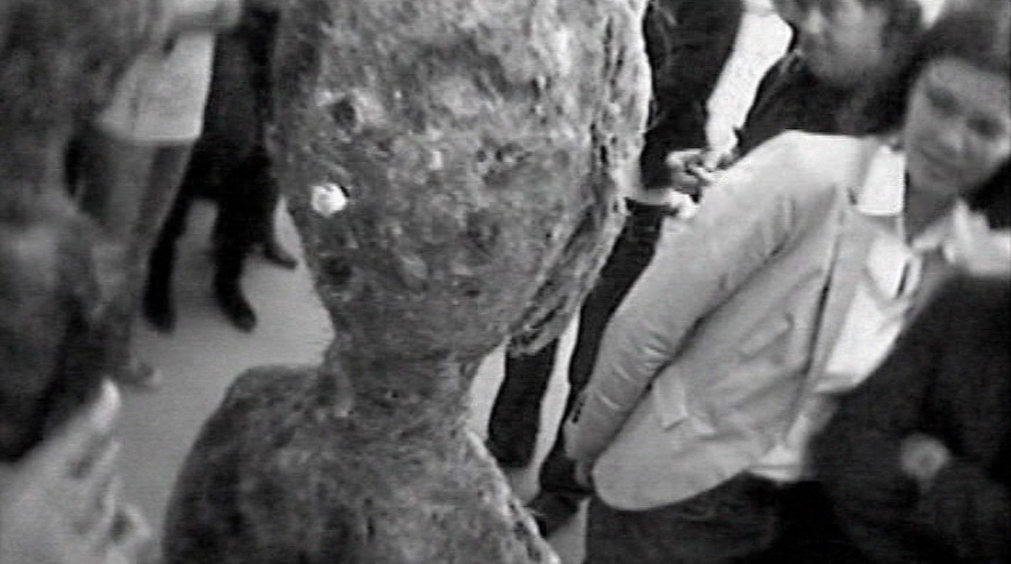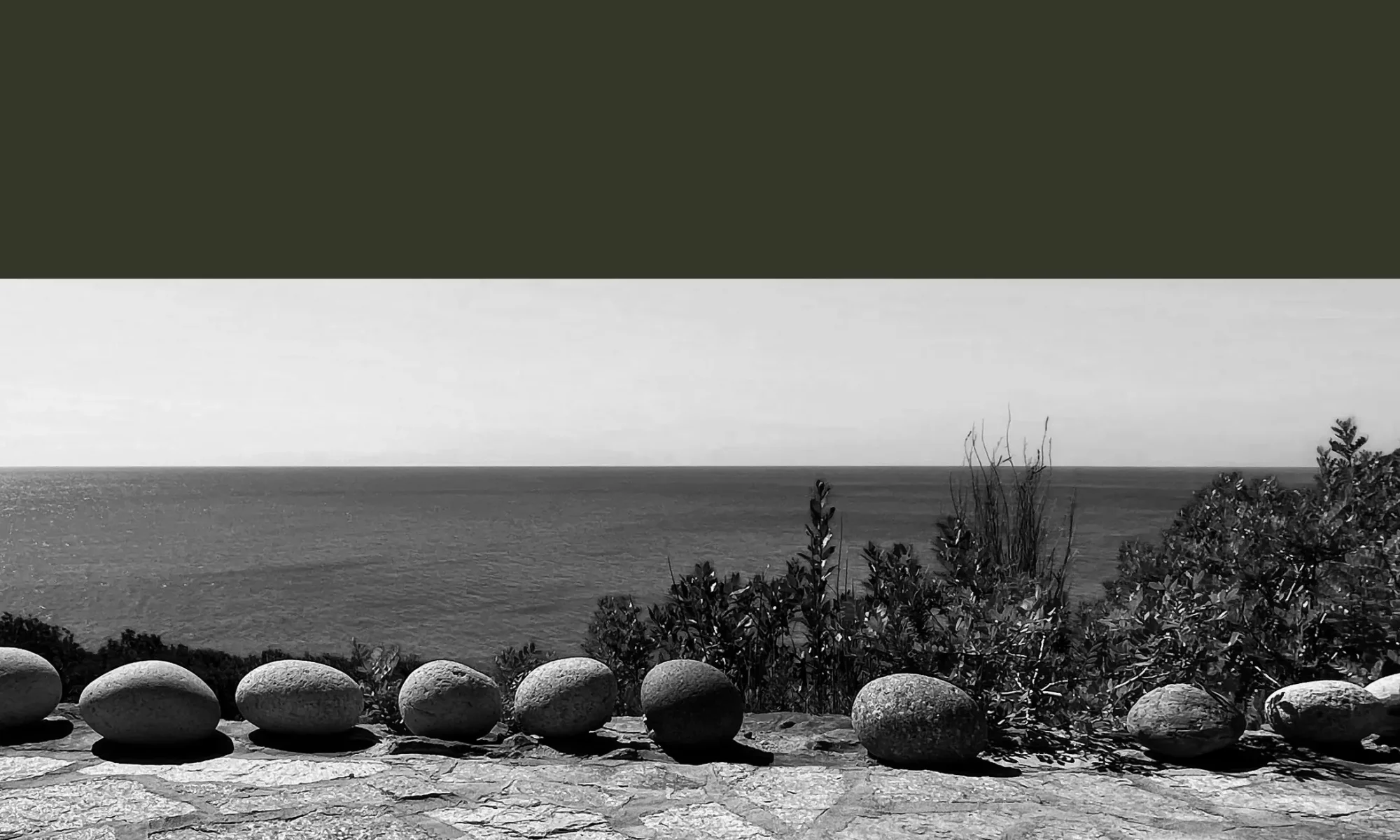Die Toten würfelten mit rosinengroßen Gehirnen, als Trommeltöne sie riefen. Eine Schamanin aus Belgien, groß gewachsen, schwarzhaarig, hockte in einem pränuraghischen Höhlengrab und schlug die „Blume des Lebens“. Sie blickten einander in die Augenhöhlen, die Schamanin und die Toten, die an den Stränden der Unterwelt ein entspanntes Leben führten. Robert Redford war gerade angekommen, die Schlange der Wartenden endlos und ständig warfen sie Münzen, um die Reihenfolge zu ändern.
Die Schamanin wollte einen Blick ins Jenseits werfen, Fühlkontakt aufnehmen. Doch die Toten scherten sich nicht um sie, rasselten fröhlich, sie werde noch genug Zeit haben das Jenseits zu erkunden, ewig sozusagen. Gekicher.
Sie erzählten vergnügt von dem Kurzfilm ‚La Pluie‘, den Marcel Broodthaers, ein echter belgischer Schamane, kürzlich unter begeistertem Gröhlen vorgeführt hatte. Ein Zauber, der Buchstaben in Tränen verwandelt. Der Kunstregen aus Wassereffekten hatte das Publikum zum Toben gebracht.
Das Gespräch erstarb, bevor es begonnen hatte. Die enttäuschte Schamanin stieg in den Mietwagen und nahm das Flugzeug zurück nach Belgien. Die Toten musizierten und klapperten mit den Knochen, Tonspur zu einem neuen cinéastischen Fest. Mal sehen, welche Schattenspiele Robert, The Lion, im Gepäck hat.