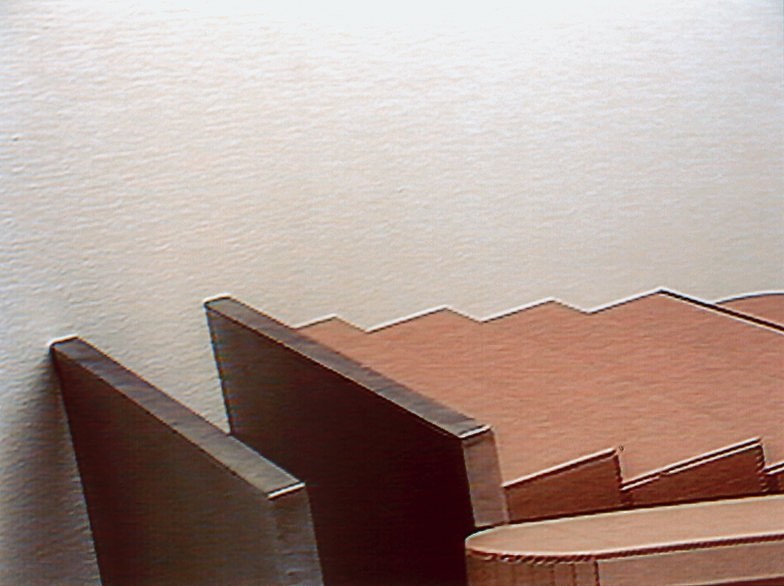Die Sammlung Grässlin in den Deichtorhallen Hamburg, 2001. Videofilm (Länge: 17:30 Min), hergestellt von Martin Kreyssig im Auftrag der Familie Grässlin. Mit Musik von Rüdiger Carl nach Texten von Werner Büttner, gespielt von Alexander von Schlippenbach (Piano), Gabi Dziuba (Stimme) und Rüdiger Carl (Stimme, Akkordeon, Drummachine).
Künstlerinnen und Künstler: Kai Althoff, Cosima von Bonin, Werner Büttner, Clegg & Guttmann, Mark Dion, Helmut Dorner, Fischli & Weiss, Günther Förg, Isa Genzken, Asta Gröting, Georg Herold, Hubert Kiecol, Martin Kippenberger, Michael Krebber, Meuser, Reinhard Mucha, Christian Philipp Müller, Christa Näher, Manuel Ocampo, Albert Oehlen, Markus Oehlen, Tobias Rehberger, Andreas Schulze, Andreas Slominski, Franz West, Christopher Williams, Joseph Zehrer, Heimo Zobernig.
Seit einem Jahrzehnt stellen die Deichtorhallen in loser Folge bedeutende Privatsammlungen der Gegenwartskunst vor. Den Auftakt dieser bislang sieben Präsentationen bildete 1991 die schweizerische Emanuel Hoffmann-Stiftung, eine hochkarätige Sammlung der Moderne. Zuletzt zeigten die Deichtorhallen 1998 unter dem Titel „Emotion“ Teile der Münchner Privatsammlung Goetz, in der junge britische und amerikanische Positionen der 90er Jahre gegenübergestellt wurden.
Die Ausstellung „Vom Eindruck zum Ausdruck – Grässlin Collection“ führt diese Reihe fort. Damit wird ein von den bisher gezeigten Sammlungen weitgehend differierender Typus des Kunstsammelns vorgestellt. Denn die „Grässlin Collection“ kann man eher als Gruppenunternehmen, als eine Art kollektives Werk sehen, an dem die fünf Familienmitglieder – Anna, Thomas, Sabine, Bärbel und Karola Grässlin – beteiligt sind und in dem sich die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten widerspiegeln.
Der Titel der Schau „Vom Eindruck zum Ausdruck“ ist einem Gemälde von Martin Kippenberger entliehen, mit dem die traditionelle Vorstellung von der Entstehung des Kunstwerks ironisch ins Gegenteil verkehrt wird. Zugleich markiert dieses Bild von 1981 die Entstehungszeit des neueren Teils der Grässlinschen Sammlung, dem die jetzige Ausstellung gewidmet ist. Die Wurzeln des mehr als 1000 Einzelposten umfassenden Kunstbesitzes liegen in der „Informellen Malerei“ und dem süddeutschen Konstruktivismus. Der 1976 früh verstorbene Unternehmer Dieter Grässlin und seine Frau Anna im badischen St. Georgen haben ein respektables Ensemble der Kunst nach 1950 zusammengetragen; darunter finden sich bedeutende Werke von Wols, Fontana, K. O. Götz, Sonderborg.
(Quelle: Deichtorhallen Hamburg)